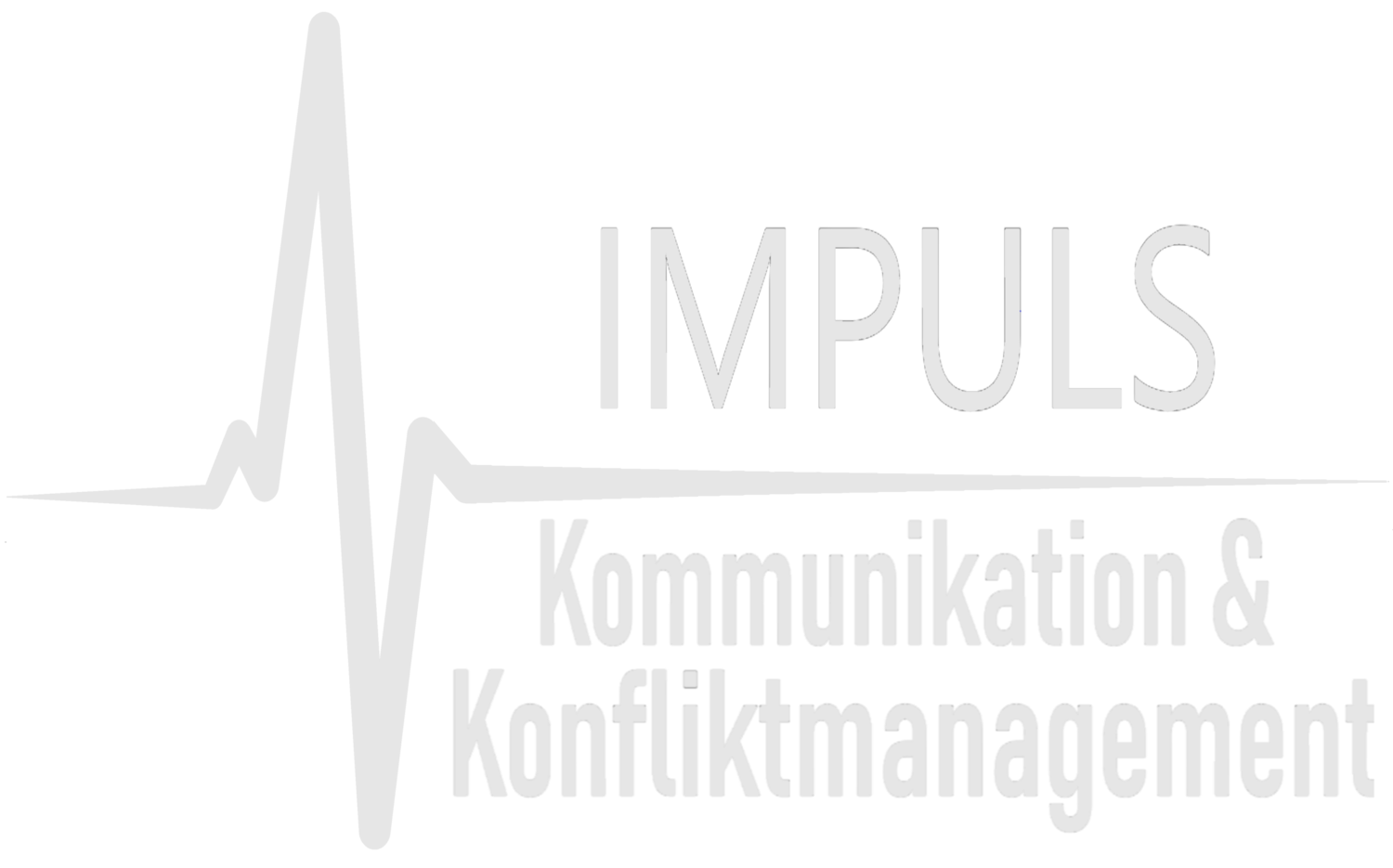“Alles neu…” - braucht Geduld
Ich weiß, ich wollte eigentlich von meinem Onboarding im neuen Job berichten, aber ehrlich gesagt wäre das momentan in zwei Sätzen erklärt. Da ich meine technische Ausstattung erst kommenden Montag bekomme, konnte ich diese Woche noch nicht wirklich viel tun. Ich hatte schon Kontakt mit einigen Kollegen. Das war sehr schön, weil ich mich unglaublich willkommen und warm aufgenommen fühle. Allerdings musste ich mir schon ein paar Mal sehr deutlich sagen, dass ich gut bin und weiß was ich tue, habe ich mich doch an der ein oder anderen Stelle ziemlich planlos gefühlt. Ich hatte wenig bis keine Ahnung, worüber im Call gesprochen wurde und auf die Frage, ob ich denn Fragen hätte, musste ich erstmal zugebe, dass ich momentan sogar zu wenig darüber weiß, was im Rahmen der Einarbeitung auf mich zukommt, um einigermaßen sinnhafte Fragen zu formulieren. Das sind tatsächlich Momente zum Genießen! Tja, ich habe es so gewollt. Aber ich habe mich entschieden ruhig zu bleiben, nicht nervös zu werden. So ist das eben, wenn man etwas ganz Neues anfängt! Dafür erinnere ich mich immer mal wieder an meine Fähigkeiten und Ressourcen. Genau so kam ich dann auch zu meinem Blog-Thema in dieser Woche. Denn worin ich wirklich extrem gut bin, das ist meine Rolle als Trainer im Lehrsaal. Meine Seminare und Workshops sind gut, schlüssig und kurzweilig. Dem Feedback folgend erreiche ich meine Teilnehmer, was mich natürlich mächtig stolz macht. Klar könnte das an meinem Charisma liegen. Aber ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass ich mein Handwerk verstehe und ein elementarer Teil dieses Handwerks ist für mich das Thema Neurodidaktik. Es ist unser Gehirn, das lernen soll, deshalb müssen wir Trainer, Coaches, Personalentwickler, Führungskräfte darüber nachdenken, was das Gehirn braucht, um lernen zu können. Das ist keine Raketenwissenschaft. Eigentlich ist es sogar recht einfach. Deshalb gibt es für euch diese Woche einen kurzen und knappen Überblick über das Thema Neurodidaktik! -Und ich verrate einige meiner wertvollsten Trainer-Geheimnisse! Viel Spaß dabei!
Lernen ist ein physiologischer Vorgang
Lernen ist im Prinzip nichts anderes als organisches Wachstum: unser Körper bildet neue synaptische Verschaltungen zwischen den Nervenzellen unseres Gehirns oder stärkt bereits vorhandene Verbindungen. Für dieses Wachstum braucht der Körper ausreichend Nährstoffe, genügend Schlaf, Bewegung (ja, Bewegung!) und die Stimulation möglichst vieler Sinneskanäle. So bilden sich mühsam neue Verschaltungen, die zu Anfang noch sehr instabil sind und auch gerne wieder kollabieren (deshalb vergessen wir). Aus diesem Grund sollte sich jeder Trainer oder Coach den Grundsatz “weniger ist mehr” sehr deutlich bei der Konzeption eines Seminars hinter beide Ohren schreiben. Klar kann ich in einen Tag drei Millionen Methoden in flotter Taktung packen. Und wahrscheinlich werden die Teilnehmer ausgesprochen positiv rückmelden, dass es abwechslungsreich war. Aber war es denn auch nachhaltig? Hundert neue instabile Synapsen, die nach drei Tagen alle wieder verpuffen, sind nicht halb so wertvoll, wie drei bleibende Lektionen, die der Teilnehmer sich mitnimmt. Also, Abwechslung und Kurzweiligkeit ja, aber dabei muss man sich als Trainer stets bewusst sein, was die Kernaussagen des Seminars sind und dabei ist weniger eben mehr!
Das Gehirn als Socializer
Der Neurobiologe Joachim Bauer schrieb: “Die stärkste Motivationsdroge für den Menschen ist der andere Mensch!” Lernen wird dann besonders effektiv, wenn es in eine soziale Situation eingebettet ist. Dass Gruppenarbeiten hierfür ein gutes Tool sind, ist hinlänglich bekannt. Um den sozialen Austausch zu initiieren, ist es zudem hilfreich, sich etwas mehr Zeit für die Vorstellungsrunde zu nehmen. Unsere Gehirne werden es uns danken. Sie fühlen sich gleich viel wohler, wenn sie wissen, mit wem sie es zu tun haben und können sich dann auch viel besser auf die Schulungsinhalte konzentrieren. Außerdem bietet es sich im Soft Skill Bereich an, die im Lehrsaal erlebte soziale Interaktion in Hinblick auf die realen sozialen Systeme der Teilnehmer zu reflektieren.
Der Sinn des Lebens
Unser Gehirn ist das einzige unserer Organe, das Bedeutung und Sinn erzeugt. Es ist sogar so, dass das Gehirn nicht funktionieren kann, wenn es keinen Sinn erkennt. Entweder schaltet es ab, oder es entwickelt sich ganz eigene Hypothesen, um arbeiten zu können. Was bedeutet das für mich als Trainer oder Coach? Es bedeutet, dass ich mir ganz genaue Gedanken darüber machen muss, welche Rolle meine Schulungsinhalte im realen Arbeitsleben und in der Unternehmenswelt meiner Teilnehmer spielen. Als Trainer sollte ich das bereits im Rahmen der Auftragsklärung in Erfahrung bringen.
Sinn bedeutet Muster
Für unser Gehirn bedeutet Sinn nicht nur, dass man mit dem Vorgestellten etwas anfangen kann, sondern auch, dass man auf bekannte Muster aufbauen kann. Als Trainer versuche ich bereits im Vorfeld in Erfahrung zu bringen, was der Wissensstand meiner Teilnehmer ist und worauf ich inhaltlich aufbauen kann. Aber auch im Seminar habe ich bereits eingangs die Möglichkeit, meine Teilnehmer direkt zu befragen. Und selbst im Verlauf des Seminars kann ich meine Teilnehmer vortrefflich einbinden, wenn ich feststelle, dass mein Inhalt womöglich schon bekannt ist. Dazu muss ich meinen Teilnehmern natürlich zuhören und dann Raum geben.
Ohne Emotionen geht gar nichts
Um die synaptischen Verbindungen bilden zu können, die uns als Muster bewusst werden, benötigt unser Gehirn die ein oder andere Zutat, die sogenannten Neuromodulatoren. Zu nennen wären hier bestimmte Hormone, wie zum Beispiel Noradrenalin oder Endorphin, dass nur zur Verfügung steht, wenn das Gehirn sich in einem (positiven) Erregungszustand befindet. Tja, deshalb muss eine erfolgreiche Schulung Spaß machen und ein guter Trainer begeistern können. Keine Angst, ein gutes Training muss nicht als Kasperletheater gestaltet werden. Es ist nicht nur das akute Glücksgefühl, das uns lernen lässt, sondern auch die Erkenntnis, dass wir das im Rahmen der Schulung dargestellte Tool zukünftig nutzen können, um in Situationen, die uns bisher verunsichert haben, sicherer und erfolgreicher agieren zu können, wie zum Beispiel beim Kennenlernen von Feedbackleitfäden oder dem Stufenmodell der Deeskalation.
Das Gehirn braucht das große Ganze
Klar könnte ich meinen Teilnehmern das Stufenmodell der Deeskalation kurz theoretisch erklären und dann davon ausgehen, dass sie es gelernt haben… Ich habe seinerzeit sehr viel übers Surfen (also auf dem Wasser) gelesen. Man könnte sagen theoretisch habe ich es gelernt. Mein erstes Mal auf einem Brett endete in einem Desaster, oder sollte ich sagen an einem Felsen?! Wie kann das sein? Ganz einfach, ich habe die Detailinformationen zwar verarbeitet, habe meinem Gehirn mit meinen Büchern jedoch nie die Möglichkeit gegeben die Details in eine komplexe Situation zu transferieren. Als Trainer gebe ich meinen Teilnehmern mit Hilfe möglichst komplexer Lernzielübungen die Möglichkeit, sich auf diesen Transferweg zu begeben. Wie oft beten mir meine Teilnehmer alle Aspekte guter Kommunikation in der Theorie ausführlich vor und eine halbe Stunde später, während einer komplexen und vielleicht auch etwas stressigen, auf jeden Fall aber lebensnahen Lernzielübung hört man sich nicht mehr zu, spricht in Rätseln oder nur in halben Sätzen, setzt voraus, dass das Gegenüber schon wissen würde, was gemeint sei und so weiter und so fort. Erst in der Reflexion dieser Übung beginnt das wirklich lernen, weil das Gehirn anfängt, den Transfer zu leisten, der für nachhaltiges Lernen und die Fähigkeit das Gelernte auch praktisch anzuwenden notwendig ist.
Lernen durch gerichtete und periphere Aufmerksamkeit
Lernen durch gerichtet Aufmerksamkeit sollte klar sein: der Teilnehmer folgt aufmerksam den Ausführungen des Seminarleiters. Aber was hat es mit peripherer Aufmerksamkeit auf sich? Wisst ihr was Priming ist? In der Psychologie bezeichnet man das Erreichen einer Reaktionstendenz durch unbewusst aufgenommene Reize als Priming. Mein gesamtes Umfeld, der komplette Lernraum, hat Einfluss auf das Lernverhalten meines Gehirns. -Jedes Poster an der Wand, die kleine “Blutzucker-Bar” hinten in der Ecke, die Vorhänge, die Stifte, das lächelnde Männchen, das ganz unscheinbar unten rechts auf der Power Point oder der Flipchart zu finden ist… Alles! Als Trainer, Coach oder Mediator ist es elementar wichtig, mir Gedanken über die Raumgestaltung zu machen, zum einen, weil ich so sehr clever Lernanreize setzen kann, zum anderen aber auch um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, in der das Gehirn optimal entspannt und damit maximal effizient lernen kann.
Bewegung - Bewegung - Bewegung
Im Prinzip haben wir zwei Arten von Gedächtnis, die wir beide gleichermaßen stimulieren müssen, um nachhaltige Lernerfolge zu erzielen. Das eine ist in meiner Vorstellung das Gedächtnis, in dem die über unsere Sinneswahrnehmungen aufgenommene Reize abgespeichert werden, also alles das, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, fühle. Im anderen Gedächtnis wird alles das abgespeichert, was ich erfahre. Diese Teile unseres Gehirns, in dem Erfahrungen abgespeichert werden, werden vor allem durch Bewegung aktiviert werden. Zu nennen wären an dieser Stelle das episodische Gedächtnis, das real erlebte Situationen speichert, das prozedurale Gedächtnis, das sowohl motorische, aber auch soziale Aktionen zur Routine werden lässt und das emotionale Gedächtnis, das Erfahrungen mit emotionaler Relevanz besonders markiert oder abspeichert. Je mehr Hirnregionen ich mit meinen Seminaren anspreche, desto nachhaltiger wird mein Seminar, weil es gleich in mehreren Hirnregionen abgespeichert wird. Keine Angst, das bedeutet nicht, dass jetzt alle die Feedbackregeln tanzen müssen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, meine Teilnehmer körperlich zu aktivieren. -Zum Beispiel, indem sie selbst an der Flipchart arbeiten, oder sich während einer Partnerreflexion im Haus bewegen dürfen, oder, oder, oder… Hier ist Kreativität gefragt. Ich kann euch nur dazu ermutigen, euch ein eigenes Repertoire für eure Seminare zu erarbeiten. Es lohnt sich.
Auch das Gehirn wird nicht jünger
Lernen ist entwicklungsabhängig. Im Kontext Schule oder Universität spielt dieser Umstand keine Rolle, da die Lernenden weitestgehend auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand sind. In der Erwachsenenbildung oder im Unternehmenskontext hat man es häufig auch in Hinblick auf das Alter der Teilnehmer mit sehr heterogenen Gruppen zu tun. Hierbei gilt es zu beachten, dass die sogenannte Neuroplastizität, also die Geschwindigkeit, in der neue Verbindungen zwischen unseren kleinen grauen Zellen gebildet werden, mit dem Alter abnimmt. Das ist einfach so. Es stimmt nicht, dass das Gehirn irgendwann ausgelernt hat. Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Aber das Lernen selbst dauert eben etwas länger. Auch die Annahme, dass die Konzentrationsfähigkeit im Alter nachlässt, ist so nicht richtig. Oft zeigen ältere Menschen sogar eine verstärkte Fähigkeit, sich länger konzentrieren zu können, allerdings wird man im Alter anfälliger für Ablenkungen, da die Fähigkeit des Gehirns, Interferenzen zu unterdrücken mit der Zeit nachlässt. Hinzu kommt, dass im Alter der Cortisol-Spiegel ansteigt, während der Dopamin-Spiegel sinkt. Ersteres führt zu erhöhter Stressanfälligkeit und zweites führt dazu, dass man nicht mehr jedem kleinen Motivations-Stöckchen hinterher springt. Wenn ich mir darüber bewusst bin, kann ich mir das alles als Trainer sogar zu nutzen machen, indem ich die jüngeren Teilnehmer von der Ruhe und der Erfahrung der älteren Teilnehmer profitieren lasse. Im Gegenzug können die jüngeren Teilnehmer die Älteren ein Stück weit mitziehen und begeistern. Im Soft Skill Bereich funktioniert das aus meiner Erfahrung sprechend ganz großartig. Im Hard Skill Bereich ist es je nach Thematik eine Überlegung wert, möglichst homogene Lerngruppen zusammenzustellen. Wichtig ist jedoch, dass ich all dem komplett wertfrei gegenüberstehe. Jede Entwicklungsstufe und jedes Alter hat Vor- und Nachteile. Als Trainer ist es niemals meine Aufgabe, dies zu bewerten, sondern mein Seminar so zu gestalten, dass es zu einer bestmöglichen Lernerfahrung für meine Teilnehmer wird.
Angst und Lernen gleichzeitig geht nicht
Um nachhaltig zu lernen, muss mein Gehirn das eben Gelernte und Erfahrene vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überspielen. Verantwortlich hierfür ist der sogenannte Hippocampus, der bei einer zu hohen Konzentration an Stresshormonen einfach seinen Dienst versagt. Außerdem haben wir ja bereits gelernt, dass wir unter anderem das Glückshormon Endorphin benötigen, damit sich Neurotransmitter bilden. Keine Sorge, man muss seine Teilnehmer jetzt nicht in Watte packen. Ein gesundes Level an Stresshormonen, diese positive Aufregung, die wir alle sicher kennen, ist sogar gut für unsere Leistungsfähigkeit, weil sie uns ausgesprochen wach und aufmerksam sein lässt. Hier macht die Dosis das Gift und um die Dosis nicht zu überschreiten, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass während des Seminars eine vertrauensvolle und entspannte Atmosphäre herrscht. Hierbei reicht es nicht, den Teilnehmern zu versprechen, dass das Gesagte nicht nach außen getragen wird. Als Trainer ist es wichtig sich nahbar zu zeigen, den Teilnehmern auf Augenhöhe zu begegnen und nicht den großen, allwissenden, einschüchternden Supertrainer zu spielen, der den unwissenden Teilnehmern schon auf die Sprünge helfen wird. Gelingt mir das, werden die Gehirne meiner Teilnehmer automatisch Oxytocin ausschütten, was nicht nur dafür sorgt, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen. Zusätzlich stimuliert Oxytocin unser Motivationszentrum und motivierte Teilnehmer wünscht sich doch jeder Trainer!
Jeder Jeck ist anders
Jedes Gehirn ist einzigartig und jede Persönlichkeit ist individuell! -Und das ist wundervoll, gut und genau richtig so. Es geht nicht darum, menschlichen Einheitsbrei zu kochen! In einer komplexen und dynamischen Welt geht es darum, möglichst heterogene Teams zu formen, die gemeinsam erfolgreich sind. Deshalb ist für mich als Trainer das Wichtigste überhaupt, dass sich meine Teilnehmer bewusst darüber werden wer sie sind und wie sie funktionieren. Erst wenn es mir gelingt, dass meine Seminarinhalte die Identitätsebene meiner Teilnehmer erreichen, werden meine Seminarinhalte auf einer höheren Ebene sinnstiftend. Hört sich hochtrabend an? Ja, stimmt! Ist aber gar nicht so schwer. Ich muss meine Teilnehmer dabei unterstützen, nicht nur die reinen Themen theoretisch zu reflektieren, sondern diese Themen auf sich und ihre individuelle Persönlichkeit zu beziehen. Dazu muss ich meinen Teilnehmern zum einen Zeit geben (also bitte keine übertrieben vollgepackten Tage). Und wenn ich noch mehr möchte (und ich möchte immer noch mehr!), kann ich meine Teilnehmer zum Beispiel mit Persönlichkeitsmodellen (wie zum Beispiel dem Big Five Modell), mit Tests, die bei der Einordnung der eigene Persönlichkeit helfen (wie zum Beispiel Selbsttests zum Kommunikationsstil, oder einer Übung zum Johari-Fenster), oder mit Gruppenübungen zur Selbstreflexion (wie zum Beispiel einer Gruppenübung zur Riemann-Thomann-Matrix) bei ihrer individuellen Selbstreflexion unterstützen.
Das war ganz schön viel, aber es gibt noch mehr
Puh, das war jetzt ein rasend schneller Überblick über die Grundideen der Neurodidaktik. Elf kleine Häppchen, direkt hintereinander serviert! Solltet ihr mehr wollen, kann ich euch eine meiner persönlichen Bibeln sehr ans Herz legen. Es folgt unbezahlte Werbung: im Buch “Neurodidaktik für Trainer” erfahrt ihr noch mehr darüber, wie ihr eure Trainings mit kleinen Tricks und Kniffen unter Berücksichtigung der neusten Erkenntnisse der Gehirnforschung effektiver und erfolgreicher gestalten könnt.
Irgendwann, noch relativ am Anfang meiner Trainerkarriere, habe ich mich recht intensiv gefragt, für wen ich das, was ich tue, mache. Und klar bin auch ich, genauso wie sicher die meisten meiner Trainerkollegen, eine kleine Rampensau. Aber als Trainer muss ich mir im Klaren darüber sein, dass ich meine Seminare nicht für mich, sondern für meine Teilnehmer gebe. Ich möchte, dass meine Teilnehmer sich wohlfühlen, Spaß haben und sich weiterentwickeln. Das ist es mir wert, mir immer wieder viele Gedanken darüber zu machen, welche Möglichkeiten ich habe, meine Seminare nicht nur inhaltlich, sondern auch didaktisch so zu gestalten, dass jedes einzelne Seminar etwas Besonderes ist, nicht nur für mich, sondern auch für meine Teilnehmer. Genau das macht mir unendlich viel Spaß und ich bin jetzt schon gespannt, wann ich im Rahmen meines neuen Jobs wieder Seminare und Workshops konzipieren und im Lehrsaal stehen darf.
Eure Constance
PS: Ich kann es nicht sein lassen! Abschließend möchte ich euch noch meinen Lieblings-Fun-Fact rund um unser Gehirn mitgeben: Teil unseres Emotionshirns ist die sogenannte Amygdala, das Angsthirn, also im Prinzip unser persönlicher Katastrophen(schutz)beauftragter. Wenn der anspringt, wird es für gewöhnlich wild und irrational, da er nur zwei Prinzipien kennt: Kampf oder Flucht! Diese Amygdala gehörte irgendwann im Laufe der Evolution mal zum Riechhirn. Ja, auf einer früheren Entwicklungsstufe gab es das mal. Der Profi nennt es Rhinencephalon. Inzwischen hat sich das Gehirn neu organisiert. Was aber geblieben ist, ist dass unsere Amygdalas eine besondere Verbindung zu Gerüchen haben. Gerüche sind bis heut die einzigen Sinneswahrnehmungen, die einen ungefilterten VIP-Zugang zu unserem Angsthirn haben. Schon mal darüber nachgedacht, mit ätherischen Ölen, die so dezent sein dürfen, dass wir sie bewusst gar nicht wahrnehmen, die Katastrophen(schutz)beauftragten eurer Teilnehmer zu entspannen? Läuft! Ehrlich! Auch im Coaching und der Mediation! It’s chemistry!