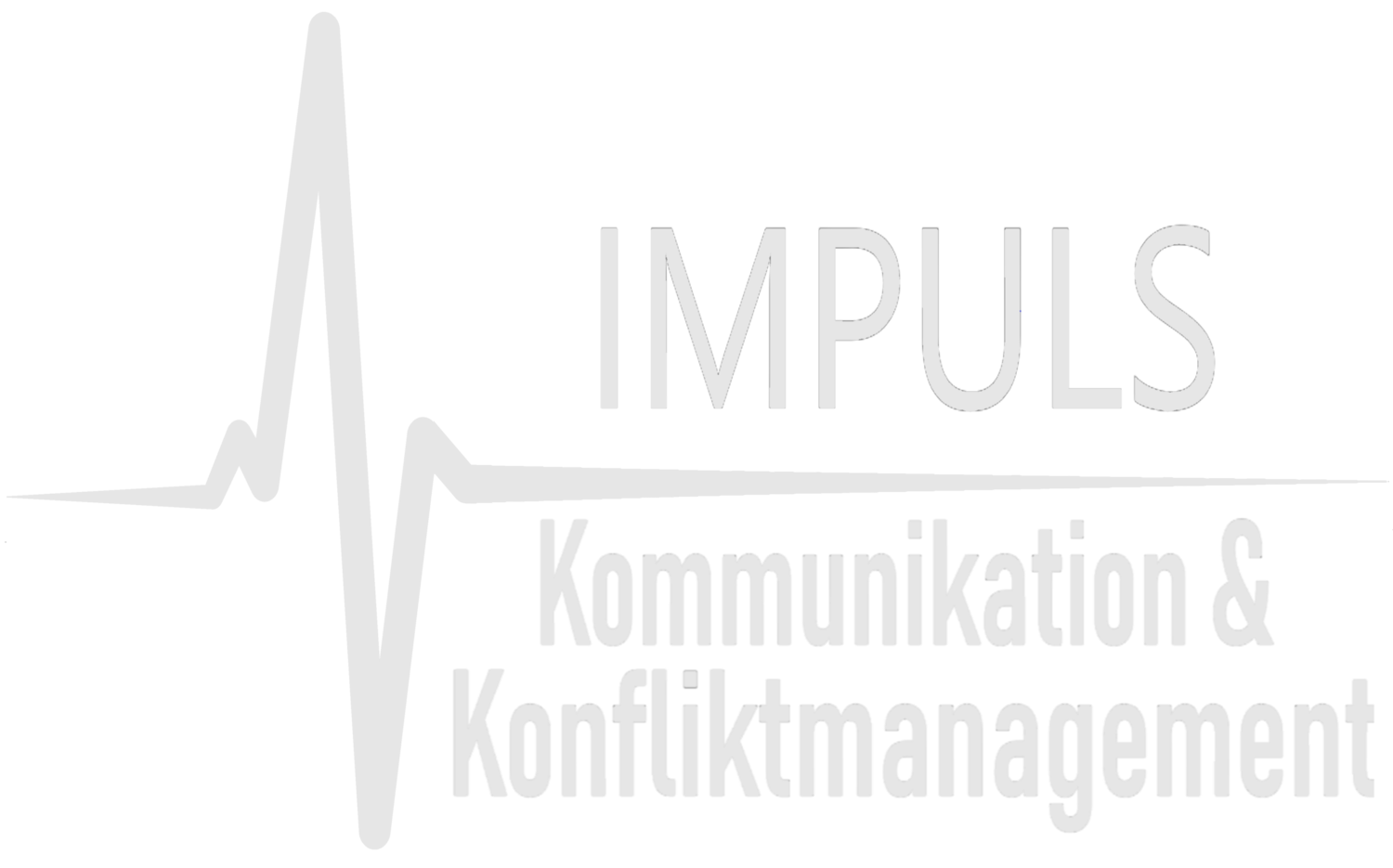Der Fehler zum Glück
“Fail fast, fail forward!” - Mit diesem Mantra bewegt sich die New Work-Bewegung nun schon seit Jahren durch die Business-Welt. Inzwischen scheint es weitverbreiteter Konsens, dass Fehler nicht nur OK sind, sondern den ultimativen Weg zum Erfolg unweigerlich flankieren. Hört man den guten alten Thomas Alva Edinson sagen “Ich bin nicht gescheitert. Ich habe 10.000 Wege gefunden, die nicht zum Ziel geführt haben.”, dann möchte man dem uneingeschränkt zustimmen, haben seine sogenannten Fehler und sein sogenanntes Scheitern doch zu legendärer Innovationskraft geführt. Aber ganz so einfach ist es eben doch nicht und dieses zauberhafte Fehler-Mantra ist aus diesem Grund auch nur eine Seite der Wahrheit. Und die andere Seite der Wahrheit kann wie so häufig ganz schön gefährlich oder kontraproduktiv sein!
Denn Fehler ist nicht gleich Fehler
Nicht alle Fehler sind gleich. Und nicht alle Fehler führen uns wie Edison mehr oder weniger direkt hin zur nächsten Innovation. Aus diesem Grund sind auch Unternehmen sehr gut beraten ihre Fehler möglichst genau zu analysieren, denn selbstverständlich waren es nicht die Wege, die nicht ans Ziel geführt haben, die Edisons Erfolg flankierten, sondern das, was Edison daraus gelernt hat. Fehler sind OK, aber feiern sollten wir die daraus resultierende Lernkurve, so es sie gibt!
Bei der Analyse von Fehlern unterscheide ich gerne in vier Kategorien:
Meine erste Kategorie ist der Flüchtigkeitsfehler, der häufig aus fehlender Fokussierung resultiert. Und nein, Flüchtigkeitsfehler sollte man nicht unbedingt feiern. Lernen kann man trotzdem aus ihnen. Denn kommt es in Teams, Organisationseinheiten, oder gar ganzen Organisationen zu einer Häufung von Flüchtigkeitsfehlern, ist es ratsam die Gesamtbelastung zu betrachten und zu schauen, auf welche Aufgaben man seinen Fokus legen möchte und welche Rahmenbedingungen es dafür zu schaffen gilt. Hierbei sollte klar priorisiert werden und natürlich muss eine rote Linie gezogen werden, die der realistisch möglichen Leistung entspricht. Kanban macht das ganz wunderbar mit den WIP-Limits, den Work-in-Progress-Limits, vor.
Meine zweite Kategorie sind die “Vogel-Strauß-Fehler”. Diese passieren häufig und sind so unglaublich menschlich. Wir legen alle Energie in eine Aufgabe oder in Projekte, die wir in absoluter Perfektion erledigen möchten, weil es uns ach so wichtig ist… Und dann geht es schief! Verdammt! Und jetzt? - Aufstehen, Krönchen richten und weiter im Text? Oder alternativ Kopf in den Sand wie dieser afrikanische Laufvogel. Auf jeden Fall nicht mehr drüber sprechen, war das Scheitern doch zu schmerzhaft. So schmerzhaft, dass man am liebsten nicht mehr darüber sprechen möchte, geschweige denn das Scheitern analysieren und daraus lernen. Menschlich absolut nachvollziehbar. Wäre das Edisons Ansatz gewesen, würde heute sicher niemand mehr seinen Namen nennen.
In einer Welt, in der wir den Fehler einfach nur feiern, kann aus “Fail fast, fail forward.” auch ganz schnell ein “Fail fast, move forward.” werden. Was fehlt ist die Lernkurve!
Die dritte Fehlergruppe ist die der Abwürgefehler (Stalling Mistakes in Englisch). Was bedeutets das? Es gibt Situationen, in denen Menschen sich so sehr auf den perfekten Prozess fokussieren, dass sie sich selbst abwürgen. Das heißt, sie erreichen nicht das erwünschte Ziel oder den gewünschten Outcome, sondern scheitern unterwegs. Man könnte auch sagen, sie bleiben liegen. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn es Menschen entweder an Sicherheit, echtem Empowerment, oder Selbstbewusstsein mangelt, oder sie sehr perfektionistisch veranlagt sind. An dieser Stelle gilt es eine Kultur der Sicherheit zu schaffen, ggf. in Kombination mit kognitiv diversen Teams. Abgesehen davon ist die Lernkurve begrenzt, da man ja nicht abschließend sagen kann, ob der Weg der richtig war, oder wenn nicht, was man daraus für den nächsten Versuch lernen kann.
Kommen wir zur vierten Kategorie, der Königsdisziplin unter den Fehlern: Die sogenannten Entwicklungsfehler (oder Stretched Mistakes in Englisch). Diese vierte Gruppe sind die einzigen Fehler, die sich nicht vermeiden lassen und die auch nicht vermieden werden sollten. Entwicklungsfehler entstehen, wenn wir etwas Neues, Unbekanntes ausprobieren und ähnlich wie Edison nicht direkt den richtigen Lösungsweg einschlagen. In einer dynamischen, komplexen und mehrdeutigen Welt sind diese Fehler unvermeidbar, wenn wir versuchen uns weiterzuentwickeln. Naturwissenschaftliche Forschung basiert von Beginn an auf diesem “Trail and Error” -Prinzip. Und ja, hier wird sich auch über jede Möglichkeit, die man fortan ausschließen kann gefreut. Hierbei ist es wichtig zum einen zu analysieren an welcher Stelle genau man die falsche Abzweigung gewählt hat und was genau man daraus für den nächsten Versuch lernt und deshalb anders macht. Natürlich ist es in einer Organisation oder einem Team auch wichtig, diese Erkenntnisse zu teilen, damit nicht jeder einzelne diesen Fehler erst selbst machen muss, sondern sich direkt auf die nächste Möglichkeit fokussieren kann. So nähert man sich über das Ausschlussprinzip mit jedem Scheitern dem tatsächlichen Lösungsweg. Aus diesem Grund ist jeder dieser Fehler eine Party wert! Außerdem erfordern diese Fehler eine Menge Mut. Schritte ins Unbekannte zu wagen ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, die in einer Kultur der psychologischen Sicherheit leichter fallen als in einem Umfeld aus Druck und Angst. Nur wenn ich das Gefühl habe, dass es sicher ist, diese Fehler zu machen, werden ich den Schritt in die neue Richtung auch tatsächlich gehen. Und nur wenn ich spüre, dass mein Scheitern tatsächlich als Chance für den nächsten Schritt bewertet wird, werde ich mein Scheitern auch teilen und gebe so einem Team oder einer gesamten Organisation die Chance mit mir gemeinsam zu lernen. So entstehen im Idealfall ganze lernende Organisationen, die mit Sicherheit die einzig wirklich langfristig erfolgreiche Organisationsform in einer Zeit sein werden, die vor allem durch Dynamik, Komplexität und fehlender Eindeutigkeit geprägt ist.
Fehlerkultur beginnt bei mir
Natürlich taucht immer wieder die Frage auf, wie denn eine solche Kultur entsteht. An dieser Stelle sei mir der Verweis auf meinen letzten Artikel erlaubt. Denn Kultur ist nur in einem sehr geringen Anteil der Rahmen, den mir eine Organisation vorgibt. Kultur ist das, was Individuen (er-)leben. In meiner beruflichen Praxis sind mir schon mehr als einmal Organisationen oder Organisationseinheiten begegnet, die perfekte Rahmenbedingungen vorweisen konnte. Alles war da, um Themen offen anzusprechen, Fehler zu teilen, Feedback zu geben. Es ist aber einfach nicht passiert. Denn natürlich muss ich Menschen dabei unterstützen, sich diesen neuen Rahmen der New Work Strukturen auch zu erschließen. Tatsächliches Empowerment entsteht nicht, indem ich Menschen sagen, dass sie nun empowered sind. New Work needs Inner Work! Und der Prozess dieser inneren Arbeit dauert mindestens mehrere Monate, wenn nicht sogar mehrere Jahre. Aus diesem Grund sollten wir Transformationen nicht vorschnell als gescheitert erklären, sondern deren Menschen bewusst unterstützen. Denn auch eine offene Feedback- oder Fehlerkultur will gelernt und in Ruhe erprobt werden.
Zum Schluss noch ein Buchtipp
Ich kann natürlich noch nicht sagen was genau die von mir so verehrte Harvard-Professorin Amy C. Edmondson in ihrem neusten Buch “Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well” beschreibt, da es erst am 5. September erscheinen wird. Aber wie auch schon mit der “Angstfreien Organisation” legt die Autorin den Finger an den Puls der Zeit. Fehlerkultur und in diesem Zusammenhang vor allem die daraus resultierende Lernkultur wird sicher eines der Topthemen der sehr nahen Zukunft sein.
Meine Ausgabe von Amys Buch ist bereits vorbestellt. Heute muss noch einmal eine andere Lektüre zum Kaffee am Sonntag herhalten. Letzte Woche bin ich in diesem Zusammenhang übrigens fatal an unserer Kaffeemaschine gescheitert. -Tasse unter den falschen Auslasser gestellt! Diagnose “Flüchtigkeitsfehler aus Übermüdung”! Wird mir diese Woche nicht nochmal passieren.
Eure Constance
Elektrisches licht sei auch nicht durch die stetige Verbesserung der Kerze entdeckt worden, sagte Oren Hariri.
Innovation braucht den Mut etwas substantiell Neues und Unbekanntes auszuprobieren. Dabei sind Fehler unvermeidbar und zeigen uns den richtigen Weg.